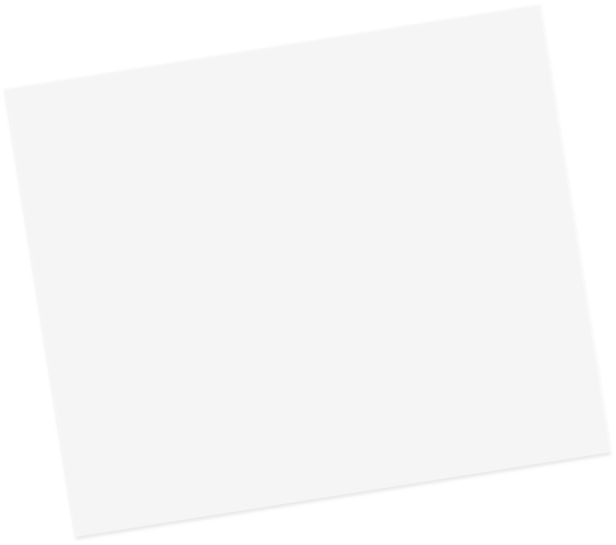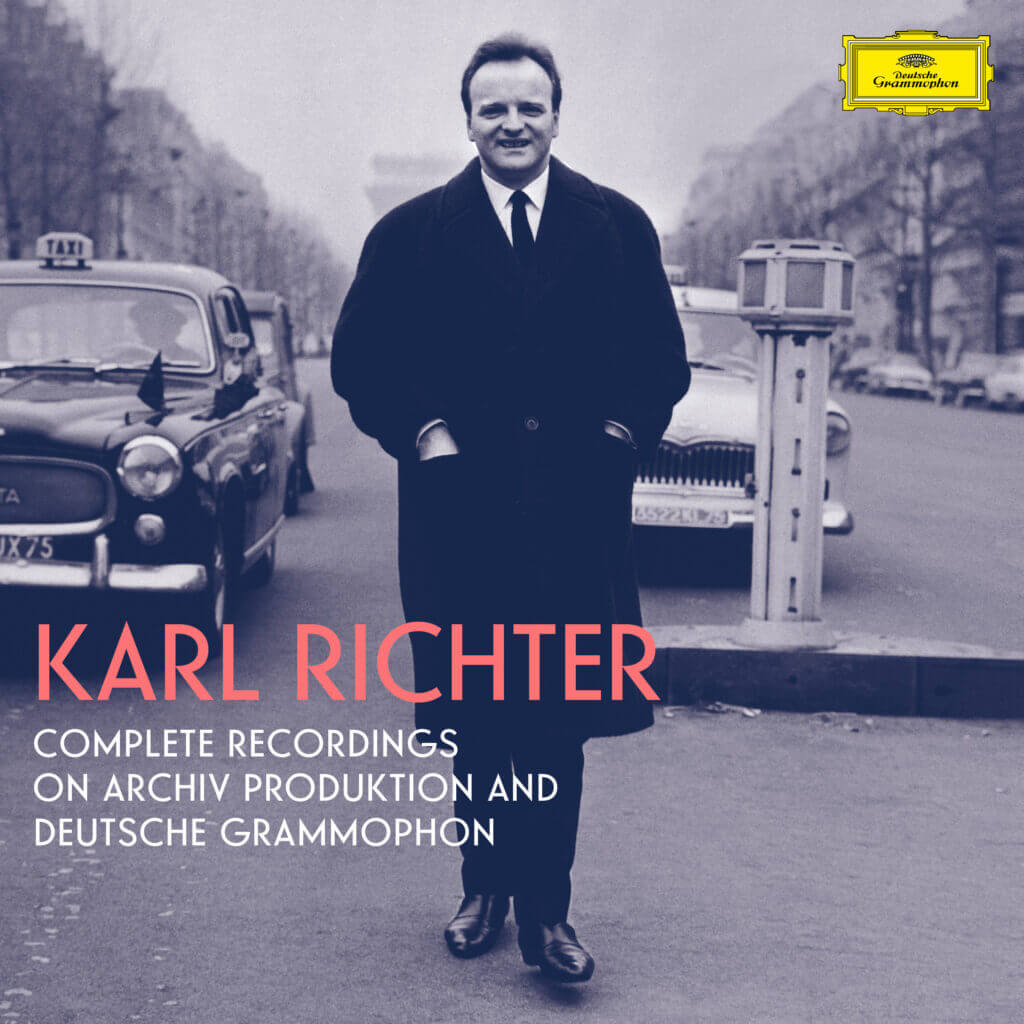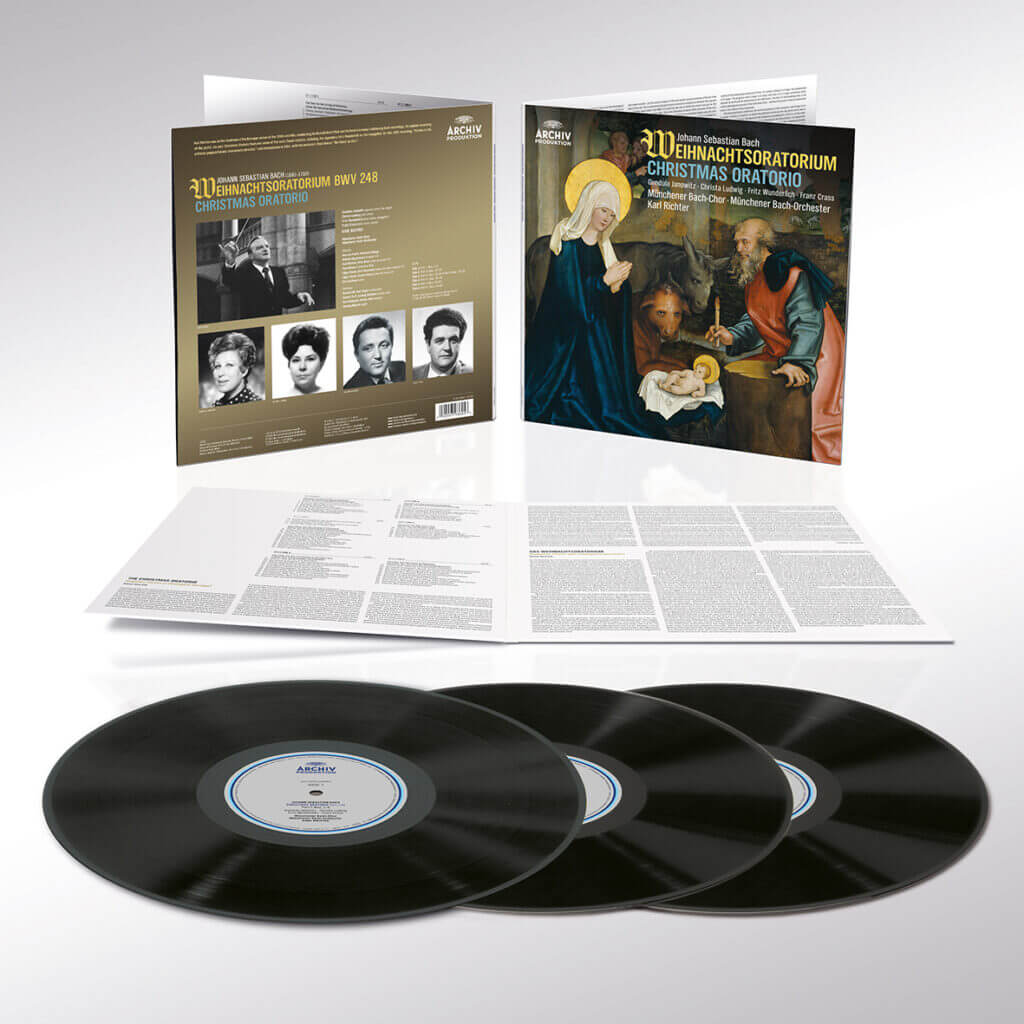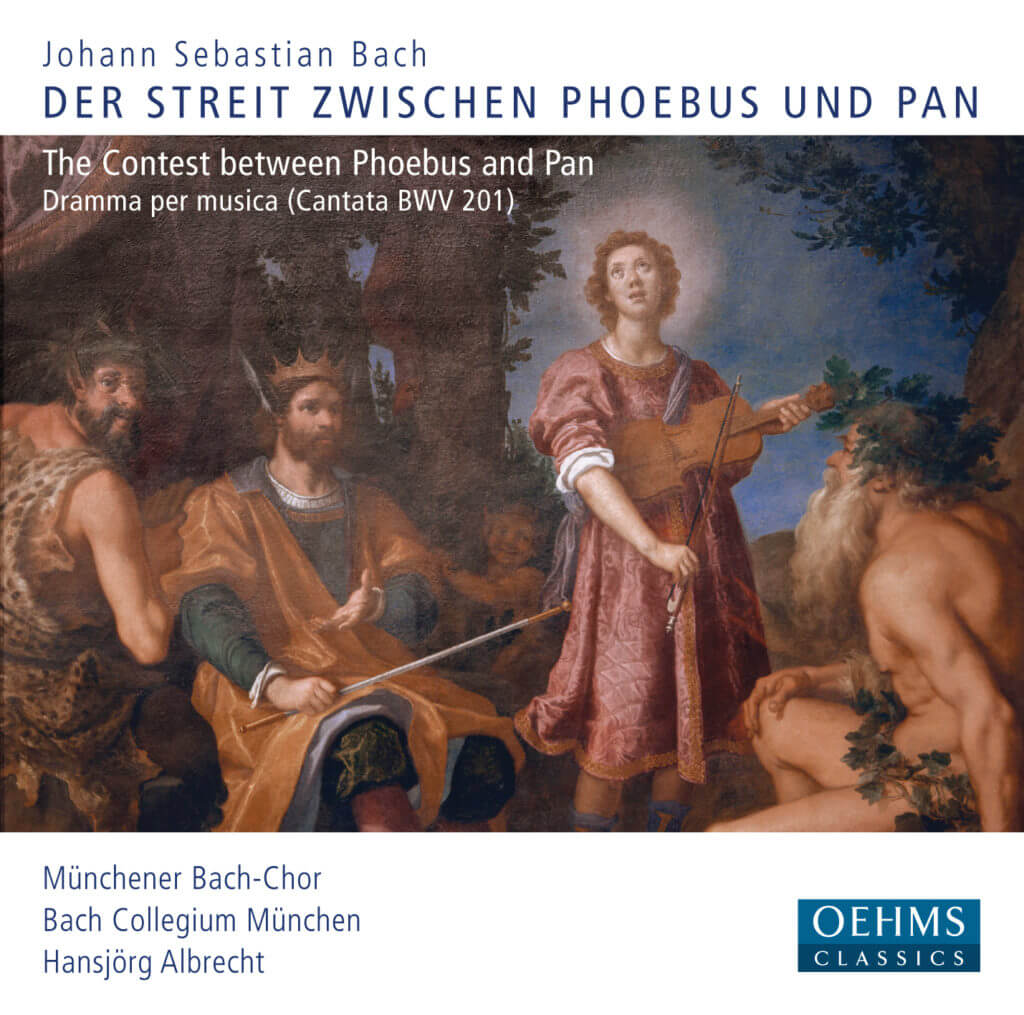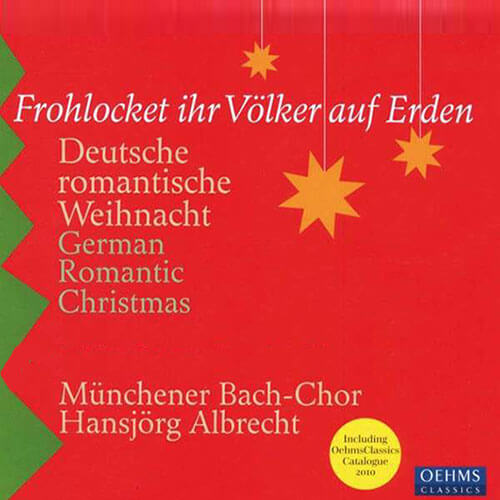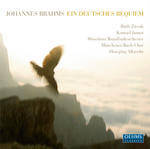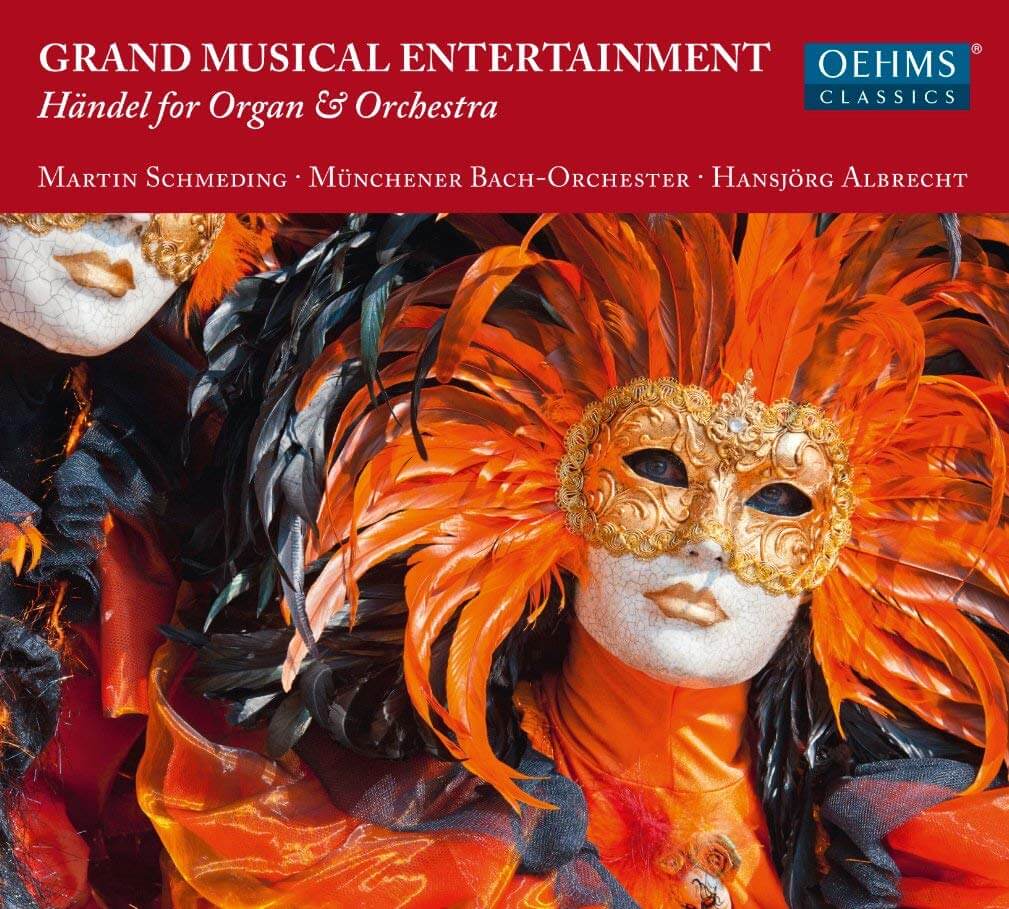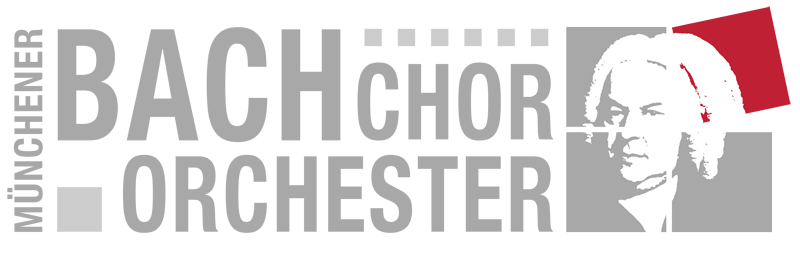CHRONIK
CHOR-GESCHICHTE
UND ENTWICKLUNG
Im Mai 2014 feierte der Münchener Bach-Chor sein 60-jähriges Gründungsjubiläum. Über ein halbes Jahrhundert lang zählt der Chor nun zu den führenden Chorvereinigungen Deutschlands; er kann auf glanzvolle Phasen ebenso zurückblicken wie auf schwierige Jahre seiner Existenz.
Die Geschichte des Münchener Bach-Chores ist mit der protestantischen Kirchenmusiktradition in Deutschland untrennbar verbunden. Dabei kann seine Entwicklung aber nie losgelöst von gesellschaftlichen und manchmal auch politischen Gegebenheiten der jeweiligen Epoche gesehen werden. Ebenso wie sich in der ganz individuellen Entwicklung des Ensembles von Anfang an und in immer stärkerem Maß bis heute die zentralen Fragen sich verändernder Musizierpraxis und Musikrezeption seit dem Zweiten Weltkrieg widerspiegeln.
SPENDENKONTO
Sie möchten die Arbeit des Münchener Bach-Chors auf ganz einfach und direkt unterstützen? Wie schön, vielen Dank!
Wir freuen uns über Ihre Spende an:
Freunde des Münchener Bach-Chores e.V.
Stadtsparkasse München
IBAN DE14 7015 0000 1004 1074 45
BIC: SSKMDEMMXXX
Übrigens: Ab einem Spendenbetrag von 100 Euro erhalten Sie automatisch eine Spendenquittung zugeschickt. Bitte geben Sie hierfür Ihre Postanschrift auf der Überweisung an.
Karl Richter (1954-1981)
Die Anfänge
1951 übernahm der junge Dirigent und Organist Karl Richter einen Lehrauftrag an der Münchner Hochschule für Musik und gleichzeitig die Kantorenstelle an der evangelischen Kirche St. Markus in München. Mit der Position als Kantor war die Leitung des Heinrich-Schütz-Kreises verbunden, einer Chorvereinigung, die sich bereits unter Richters Vorgänger, Professor Michael Schneider, intensiv besonders der Pflege des Werkes von Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach gewidmet hatte.
Karl Richter, 1926 als viertes Kind einer Pfarrersfamilie in Plauen/Vogtland geboren, war 1938 in den Dresdner Kreuzchor aufgenommen worden. Noch während seiner Schulzeit war er als außergewöhnlich begabter Organist aufgefallen und hatte Unterricht bei Karl Straube am Kirchenmusikalischen Institut des Konservatoriums in Leipzig erhalten. Nach einer zweijährigen Unterbrechung durch Einberufung und Kriegsgefangenschaft (1943-45) konnte er seine Studien in Leipzig bei K. Straube und später Günther Ramin fortsetzen. Nach dem Staatsexamen wurde dem erst 23-jährigen Richter 1949 das Amt des Organisten an St. Thomas zu Leipzig übertragen.
Die Übersiedelung Richters von Leipzig nach München 1951 war der Anfangspunkt einer beispiellosen Weltkarriere. Dem jungen Musiker, der sich von Beginn an zum Ziel gesetzt hatte, sich in Süddeutschland einen eigenen Wirkungskreis nach dem Vorbild der großen sächsisch-protestantischen Musiktradition zu schaffen, gelang es, den Heinrich-Schütz-Kreis schnell für seine Arbeit zu begeistern. In kürzester Zeit erfuhr das Ensemble regen Zulauf von begeisterten jungen Laiensängern und damit eine entscheidende Steigerung der künstlerischen Qualität.
Im katholisch geprägten München stieß Karl Richter mit seinen Ambitionen in ein Vakuum: Auch wenn es jährliche Aufführungen der „Matthäus-Passion“ am Karfreitag schon seit langem gegeben hatte, waren doch weite Teile des Bachschen Werks, insbesondere die Motetten und Kantaten, dem Publikum nahezu unbekannt. Richter setzte von Anfang an Akzente in der Programmgestaltung. In Zusammenarbeit mit dem evangelischen Dekan Theodor Heckel richtete er 1952 die Münchner Abendmusiken ein: Einmal monatlich, jeweils am letzten Freitag, erklangen geistliche Werke für Chor und Orgelmusik in St. Markus. Das Publikum erhielt zu diesen Veranstaltungen freien Eintritt, lediglich der Kauf eines Programms für wenige Pfennige war Pflicht. Das Programmheft zur ersten Abendmusik benennt bereits deutlich einige der Programmschwerpunkte, die für den Münchener Bach-Chor über Jahrzehnte maßgeblich waren und dies großteils auch bis heute geblieben sind: Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach, auch Georg Friedrich Händel standen im Zentrum der Arbeit, aber auch frühe Werke der Kirchenmusik und die großen Komponisten der Klassik und der Romantik (etwa Johannes Brahms, Anton Bruckner und Max Reger) und des 20. Jahrhunderts wurden erarbeitet. Außerhalb dieser regelmäßigen Abendmusiken führten Karl Richter und der Chor mit der „Messe in h-Moll“ und der „Johannes-Passion“ bereits 1952 große Bachsche Werke auf.
Der Erfolg der neuen Veranstaltungen in St. Markus war überwältigend. Ein durch die Entbehrungsjahre des Krieges und der ersten Zeit des Wiederaufbaus kulturell regelrecht „ausgehungertes“ Publikum entdeckte die Welt eines Johann Sebastian Bach und war fasziniert von dem jungen in Leipzig bei K. Straube und später Günther Ramin fortsetzen. Nach dem Staatsexamen wurde dem erst 23-jährigen Richter 1949 das Amt des Organisten an St. Thomas zu Leipzig übertragen.
Die Übersiedelung Richters von Leipzig nach München 1951 war der Anfangspunkt einer beispiellosen Weltkarriere. Dem jungen Musiker, der sich von Beginn an zum Ziel gesetzt hatte, sich in Süddeutschland einen eigenen Wirkungskreis nach dem Vorbild der großen sächsisch-protestantischen Musiktradition zu schaffen, gelang es, den Heinrich-Schütz-Kreis schnell für seine Arbeit zu begeistern. In kürzester Zeit erfuhr das Ensemble regen Zulauf von begeisterten jungen Laiensängern und damit eine entscheidende Steigerung der künstlerischen Qualität.

Im katholisch geprägten München stieß Karl Richter mit seinen Ambitionen in ein Vakuum: Auch wenn es jährliche Aufführungen der „Matthäus-Passion“ am Karfreitag schon seit langem gegeben hatte, waren doch weite Teile des Bachschen Werks, insbesondere die Motetten und Kantaten, dem Publikum nahezu unbekannt. Richter setzte von Anfang an Akzente in der Programmgestaltung. In Zusammenarbeit mit dem evangelischen Dekan Theodor Heckel richtete er 1952 die Münchner Abendmusiken ein: Einmal monatlich, jeweils am letzten Freitag, erklangen geistliche Werke für Chor und Orgelmusik in St. Markus. Das Publikum erhielt zu diesen Veranstaltungen freien Eintritt, lediglich der Kauf eines Programms für wenige Pfennige war Pflicht. Das Programmheft zur ersten Abendmusik benennt bereits deutlich einige der Programmschwerpunkte, die für den Münchener Bach-Chor über Jahrzehnte maßgeblich waren und dies großteils auch bis heute geblieben sind: Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach, auch Georg Friedrich Händel standen im Zentrum der Arbeit, aber auch frühe Werke der Kirchenmusik und die großen Komponisten der Klassik und der Romantik (etwa Johannes Brahms, Anton Bruckner und Max Reger) und des 20. Jahrhunderts wurden erarbeitet. Außerhalb dieser regelmäßigen Abendmusiken führten Karl Richter und der Chor mit der „Messe in h-Moll“ und der „Johannes-Passion“ bereits 1952 große Bachsche Werke auf.
Der Erfolg der neuen Veranstaltungen in St. Markus war überwältigend. Ein durch die Entbehrungsjahre des Krieges und der ersten Zeit des Wiederaufbaus kulturell regelrecht „ausgehungertes“ Publikum entdeckte die Welt eines Johann Sebastian Bach und war fasziniert von dem jungen Laienensemble, das mit bedingungslosem Einsatz seinem Leiter folgte. Schon im ersten Jahr war die Kirche am Freitagabend oft völlig überfüllt. 1954 schließlich konnten die Abendmusiken um einen wichtigen Bereich erweitert werden: In 14-tägigem Rhythmus wechselten sich nun Motetten- und Kantatenaufführungen ab. In dieses Jahr fällt auch die eigentliche Gründung des Münchener Bach-Chores. Am Jahresanfang hatte sich noch der Heinrich-Schütz-Kreis präsentiert, das Programm der Abendmusik vom 28. Mai 1954 weist das Ensemble erstmalig als „Münchener Bach-Chor“ aus. Auch unter neuem Namen blieb der Chor der Markuskirche verbunden, organisatorisch und rechtlich aber war er von nun an ein eingetragener Verein.

Rasch nahm die Zahl der Konzertverpflichtungen zu. Bereits das Jahresprogramm 1955, unter dem Gesamtmotto „München bekennt sich zu Johann Sebastian Bach“, weist die für heutige Verhältnisse unvorstellbare Zahl von nahezu 30 Veranstaltungen des Bach-Chores aus, außer den beiden Bachschen Passionen, der „Messe h-Moll“, dem „Weihnachtsoratorium“ und dem Weihnachtsliederabend fanden 9 Motettenabende, 9 Kantatenkonzerte (mit insgesamt 18 der Kirchenkantaten Bachs), vier Orgelkonzerte und 3 Kammermusik-Abende statt.
Die quantitative Ausdehnung der Programme brachte rasch auch eine Erweiterung des künstlerischen Repertoires mit sich. Zwar bildete in den Anfangsjahren – wie auch später – das Schaffen des Namenspatrons immer den Kern der Arbeit des Münchener Bach-Chores, doch finden sich daneben z.B. in den Jahren 1955 und 1956 auch etliche Werke alter Meister; überraschenderweise liegt außerdem bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ein deutlicher Schwerpunkt auf der Musik des 20. Jahrhunderts mit Werken von Hugo Distler, Ernst Pepping, Johann Nepomuk David, Zoltan Kodály und Heinrich Kaminski. Auch außerhalb von München wurde man nun auf Karl Richter und seinen Chor aufmerksam: Erste auswärtige Verpflichtungen, zunächst innerhalb Bayerns, ergänzten das Programm, außerdem produzierte Telefunken/Decca ab 1955 erste Schallplatteneinspielungen mit Werken von Bach, Händel und Mozart. Dabei wirkten bereits viele spätere ständige Mitglieder des Münchener Bach-Orchesters mit, das zu diesem Zeitpunkt allerdings noch den schlichten Titel „Ein Kammerorchester“ trug.
Erste Schritte zum Weltruhm: Die Bach-Woche Ansbach
Ab 1956 wurde Karl Richter als Solist und Dirigent regelmäßig zur Bach-Woche Ansbach verpflichtet, die zunächst noch jährlich, später im zweijährigen Turnus stattfand.
In der Abgeschiedenheit des Klosters Heilbronn, in dem Chor, Orchester, Solisten und Dirigent zu einer mehrwöchigen Klausur zusammenfanden, waren ideale Arbeitsbedingungen für das ganze Ensemble gegeben. Fern von Terminzwängen und Alltagsgeschäften konnte man sich in Ruhe der Vorbereitung der Konzerte widmen und notwendige Aufbau- und Perfektionierungsarbeit leisten. Die Tagespläne des Chores zeugen beispielsweise davon, dass in diesen Wochen für jede Stimmgattung täglich mindestens eine halbe Stunde Stimmbildung vorgesehen war. Über viele Jahre hinweg betreute Professor Hanno Blaschke (Musikhochschule München) die Sängerinnen und Sänger als Stimmbildner.
Ansbach machte den Chor endgültig zu einer verschworenen Gemeinschaft und band auch viele Instumental- und Vokalsolisten dauerhaft in enger Zusammenarbeit an Karl Richter. Für die Chorchronik sei auch vermerkt, dass in dieser Zeit manch lebenslange Freundschaft zwischen Choristen und Musikern geknüpft wurde und natürlich auch Raum für gemeinsame Freizeitbeschäftigung war, wovon beispielsweise die Bilder vom gemeinschaftlichen Fußballturnier zeugen.

Die kleine fränkische Stadt Ansbach wurde in jenen Jahren zum Treffpunkt der Musiker-Elite aus der ganzen Welt. Dies sicherte dem Bach-Fest regelmäßig die internationale Aufmerksamkeit des Publikums und der Fachwelt. Bis in die sechziger Jahre hinein blieben Karl Richter und sein Chor die prägenden Interpreten. Am Rande der Bach-Woche Ansbach kam es für den Chor allerdings auch zu Begegnungen mit Persönlichkeiten, die erst viel später in seiner Geschichte eine wichtige Rolle spielen würden: Ab 1961 konzertierte der spätere Künstlerische Leiter Hanns-Martin Schneidt als Dirigent und Solist regelmäßig in Ansbach, 1964 saß Ekkehard Tietze, der Freund Richters aus der Leipziger Zeit und spätere Interimsleiter des Chores, bei einer Aufführung der „Matthäus-Passion“ an der Orgel.
Die fulminanten Erfolge des Chores in Ansbach, die u.a. durch Rundfunk-Übertragungen dokumentiert wurden, machten ein internationales Publikum auf das Ensemble aufmerksam. Erste Gastspieleinladungen ins Ausland folgten (1957, 1958 und 1959 jeweils nach Italien, 1962 nach Paris). Das Jahr 1958 markierte außerdem den Beginn einer über zwanzig Jahre währenden exklusiven Zusammenarbeit mit der Deutschen Grammophon Gesellschaft, vor allem mit deren Archiv-Produktion.
Am Ende der ersten Dekade von Richters Wirken war München zur zweiten Bach-Stadt in Deutschland geworden. Der Ruf des Münchener Bach-Chores als eines einzigartigen jungen Ensembles begann sich in alle Welt zu verbreiten: „Ohne zu ermüden, ohne der Lethargie der Erfolgreichen anheim zu fallen, vollzog er eine Entwicklung, die nichts Geringeres war als die Selbstentfaltung einer der wenigen Elementarbegabungen unserer Gegenwart. 10 Jahre Karl Richter in München – das bedeutet die Einbürgerung der besten Thomaskirchentradition in unserer Stadt. Wo Richter wirkt, ist das beste Erbe Bachs, das Leipzig der Motetten, Passionen und Orgelfugen!“ (aus einem Artikel von R. Müller, 1962)
Auf dem Höhepunkt des Erfolgs: Der Münchener Bach-Chor zwischen 1964 und 1980
Im Jahr 1964 begann mit einer dreiwöchigen Konzertreise nach Italien eine ausgedehnte Reisetätigkeit des Münchener Bach-Chores. Dem Wunsch der einladenden Veranstalter entsprechend, kamen dabei vorwiegend die Werke Johann Sebastian Bachs zur Aufführung. Unter anderem war der MBC in folgenden Ländern zu Gast:
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1972
1973
1974
1976
1978
1979
1980
Italien
USA, Frankreich
Finnland, England
Österreich, Kanada, USA, Italien, Schweiz, England
Sowjetunion
Japan
Sowjetunion
Griechenland, USA
England
Schweiz, Österreich
Frankreich
Jugoslawien
Frankreich, Spanien
Luxemburg
Unabhängig von diesen großen Reiseprojekten begann in jener Zeit die regelmäßige Zusammenarbeit mit namhaften Veranstaltern, z. B. dem Großen Festspielhaus in Salzburg (jährlich zu Weihnachten) und den Sommerkonzerten Ottobeuren (jährlich im Sommer). Die regelmäßigen Konzertverpflichtungen in München wurden selbstverständlich in vollem Umfang beibehalten, lediglich die Abendmusiken konnten nicht mehr im gewohnten 14-tägigen Rhythmus stattfinden.
Fragt man die Chormitglieder dieser Zeit nach diesen Glanzjahren in der Geschichte des Bach-Chores, so wissen sie von den mitreißenden Konzerterlebnissen zu berichten, von Empfängen in Botschaften, vom nicht enden wollenden, begeisterten Applaus des Publikums, von lustigen Begebenheiten am Rande der Konzerte. Vor allem aber erzählen sie vom absoluten Einsatz jedes einzelnen Sängers für seine Gemeinschaft und von der absoluten Hingabe an die Sache. Anders ist auch kaum zu erklären, wie es möglich war, dass die rund 130 Mitglieder dieses Laienensembles wie selbstverständlich Familie und Beruf hintanstellten, bis zu 100 Abende im Jahr dem Chor widmeten und jahrelang fast vollständig auf privaten Jahresurlaub verzichteten.
Dabei waren die äußeren Umstände der Reisen nicht immer mit heutigen Maßstäben zu vergleichen: Nach Süditalien beispielsweise reisten Chor, Orchester, Solisten und Dirigent 30 Stunden lang mit dem Sonderzug, und es wurde dennoch nicht als ungewöhnlich empfunden, dass direkt nach der Ankunft spätabends vor Ort noch eine Probe angesetzt war. Jede Reise hatte ihre eigenen Erlebnisse und Höhepunkte – was beispielsweise einen Laiensänger bewegt, wenn es ihm vergönnt ist, in einer ausverkauften Carnegie-Hall in New York zu singen, kann wohl im Rahmen einer solchen Chronik ohnehin nicht mit Worten erfasst werden.
In allen Einzelheiten jedoch ist allen Beteiligten bis heute die erste Reise in die damalige Sowjetunion im Gedächtnis. Die Konzerte des Ensembles in Moskau und Leningrad (dem heutigen Sankt Petersburg) im April 1968 waren im Rahmen eines auf höchster politischer Ebene vereinbarten Kulturaustausches möglich geworden. Es war die Zeit des Kalten Krieges, die Beziehungen zwischen beiden Ländern waren angespannt, offizielle Aufführungen geistlicher Werke und damit der Musik Bachs hatte es im atheistischen Russland seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Als die Musiker in der Lufthansa-Sondermaschine nach Moskau saßen, konnten sie nicht ahnen, was sie bei den Konzerten erwarten würde: Die Karten, obwohl zu horrenden Preisen angeboten, waren innerhalb weniger Stunden restlos ausverkauft gewesen, und etliche Besucher, die zum Teil von sehr weit her angereist waren, waren leer ausgegangen. Der Andrang vor dem Tschaikowsky-Konservatorium war so groß, dass die glücklichen Besitzer von Eintrittskarten nicht weniger als 4 Polizeisperren passieren mussten, um in den Saal zu gelangen. Am zweiten Abend schließlich durchbrachen die Menschenmassen die Sperren. Über verborgene Gänge und über das Dach versuchten sie, doch noch in den Saal zu gelangen. Die Chormitglieder taten in dieser Situation das ihre: Sie verliehen schlicht ihre Konzertkleidung und die Noten, um russischen Studenten, die dann als Chormitglieder getarnt waren, den Zutritt zu ermöglichen. Diese saßen dann während des Konzerts dichtgedrängt hinter dem Podium auf dem Fußboden. Die Eindrücke dieser Reise waren überwältigend, die Strapazen enorm – und dennoch beflügelte das Erlebte den Chor ganz offensichtlich zu Höchstleistungen, wie es Kammersänger Kieth Engen in einem Reisebericht für die Abendzeitung am 27./28.4.1968 formulierte: „Sie hatten allen Grund, müde zu sein – körperlich und stimmlich, aber dann passierte eines dieser Wunder, das wir manchmal auf dem Podium oder auf der Bühne erleben dürfen: Sie sangen eine der schönsten h-Moll-Messen, die ich sie je habe singen hören. Ich glaube, ich darf es auch im Namen meiner Solistenkollegen, des großartigen Bach-Orchesters und Karl Richters aussprechen: Es war eine Freude, an diesem Abend euer Partner zu sein!“
Seit 1964 hatte sich Karl Richter von der Bach-Woche Ansbach zurückgezogen; stattdessen wurden in München eigene Bach-Feste geschaffen, in denen er seine künstlerischen Vorstellungen besser verwirklichen konnte, als es ihm im Ansbacher Rahmen möglich war. Diese Bach-Feste wurden in den ersten Jahren jährlich veranstaltet und entwickelten sich schnell zu Publikums-Magneten. Richter holte sich hochkarätige Künstler aus aller Welt als Partner nach München, scheute sich aber auch nicht, Interpreten und Ensembles zu präsentieren, die eine seiner eigenen Musizierweise gänzlich entgegengesetzte Interpretation bevorzugten. So führte Nikolaus Harnoncourt mit seinem Concentus Musicus Wien bereits während des Bach-Festes 1971 Orchesterwerke von Johann Sebastian Bach auf historischen Instrumenten auf, mit dem Cembalisten Gustav Leonhardt wurde im selben Jahr ein zweiter Spezialist für historische Aufführungspraxis verpflichtet. Man legte Wert auf Vielseitigkeit und eine große Bandbreite der Aufführungen, nicht aber auf repräsentative Spielorte: Das Bach-Fest 1976 fand zum Beispiel außer in der Markuskirche nur in der Musikhochschule und in der Lukaskirche statt, auf die großen Konzertsäle der Stadt wurde verzichtet.
Der Münchener Bach-Chor als Repräsentant des Medienzeitalters
Nachdem bereits Ende der fünfziger Jahre eine Reihe von Schallplatteneinspielungen produziert worden waren, kam es in den sechziger und siebziger Jahren zu einer wahren Flut von Aufnahmen für die Deutsche Grammophon Gesellschaft, ab 1969 mit der vermehrten Bedeutung des Fernsehens auch zu mehreren großen TV-Produktionen. Aufnahmen bedeuteten für das Ensemble in der Regel mehrere Tage der Abwesenheit vom Dienst und unbezahlten Urlaub, der durch die von den Produktionsfirmen ausgezahlten Tagegelder nicht immer ausgeglichen werden konnte. Im Jahr 1969 war die zeitliche Belastung der Chormitglieder schließlich ausgereizt, wie der folgende Jahresplan zeigt:
Veranstaltungsplan 1969 (nur Konzerte und Aufnahmen, keine Proben)
04. Januar
19. Januar
30. Januar
09. Februar
11. Februar
23. Februar
28. Februar
09. März
15. März
30. März
09. April
23. April – 11. Mai
30. Mai
07. Juni
15. Juni
21. Juni – 29. Juni
06. Juli
09. Juli – 10. Juli
13. Juli
27. Juli
05. August – 08. August
19. September – 21. September
26. Oktober
27. Oktober
23. November
28. November
10. Dezember
11. Dezember
13. Dezember
20. Dezember
„Weihnachtsoratorium“ Teil II
Gottesdienst in St. Markus
Kantatenkonzert
Gottesdienst in St. Markus
J. Haydn, „Die Jahreszeiten“
Gottesdienst in St. Markus
G. Verdi, „Messa da Requiem“
Gottesdienst in St. Markus
J.S. Bach, „Johannes-Passion“
J.S. Bach, „Matthäus-Passion“
G.F. Händel, „Giulio Cesare“ (Aufnahme für DG)
Konzertreise nach Japan mit J.S. Bach, „Matthäus-Passion“ (3x),
„Johannes-Passion“ (1x), „Messe h-Moll“ (3x), Kantaten (Nr. 12,30,31,50,103,147), „Magnificat“
Motettenkonzert in St. Michael
Motettenkonzert in Schwetzingen
Gottesdienst in St. Markus
Bach-Fest in München mit Motetten, Kantaten (2x), „Johannes-Passion“ und „Messe h-Moll“
G.F. Händel, „Belsazar“ in Ottobeuren
Kantaten-Aufnahmen für DG
Gottesdienst in St. Markus
Kantatenkonzert (Nr. 21,55)
L. v. Beethoven, „C-Dur-Messe“ (Aufnahme für DG)
J.S. Bach, „Messe h-Moll“ (Fernseh-Aufzeichnung in Dießen)
Gottesdienst in St. Markus
G.F. Händel, „Der Messias“
Kantatenkonzert (140,20,95)
Motette in St. Michael
„Weihnachtsoratorium“ Teil I
„Weihnachtsoratorium“ Teil II
„Weihnachtsoratorium“ Teil I+II in Salzburg
Weihnachtsliederabend

Von etwa Mitte der siebziger Jahre an nahm der Umfang der Verpflichtungen für den Chor ab. Dies hatte einerseits interne Gründe: Alle bedeutenden Werke von Johann Sebastian Bach und wichtige Werke von etlichen anderen Komponisten wie W.A. Mozart, L. v. Beethoven, Chr. W. Gluck oder G. F. Händel lagen bereits als Schallplatteneinspielungen vor; bis zu diesem Zeitpunkt waren außerdem insgesamt etwa 80 der geistlichen Kantaten Bachs für die Deutsche Grammophon aufgenommen worden. Andererseits wirkte sich die mit der Ölkrise beginnende wirtschaftliche Rezession auch auf den Kulturbetrieb aus: In- und ausländische Veranstalter sahen sich nicht mehr ohne weiteres in der Lage, Reisekosten für ein ca. 140-köpfiges Ensemble zu finanzieren, und öffentliche Fördergelder flossen spärlicher. Waren viele der Reisen des Chores vorher noch mit großzügiger Unterstützung des Auswärtigen Amtes zustande gekommen, so musste man nun versuchen, die Unkosten aus eigenen Mitteln beziehungsweise mit Hilfe der Eintrittsgelder zu decken. Dennoch blieb der Chor im internationalen Geschäft, und auch die Bach-Feste in München waren weiterhin Anziehungspunkte für die Besucher, von denen nicht wenige eigens zu diesem Anlass nach München reisten.
In seinen letzten Lebensjahren widmete sich Karl Richter zunehmend auch der großen Symphonik und der Oper, vorrangig in München, Wien und Buenos Aires. Nach einer kurzen Phase eingeschränkter Tätigkeit, bedingt durch gesundheitliche Probleme und die Verlegung seines Hauptwohnsitzes in die Schweiz, widmete er sich wieder besonders intensiv der Arbeit mit „seinem“ Chor und reiste regelmäßig nach München, um die Mehrzahl der Proben selbst halten zu können. 1979 nahm er die “Matthäus-Passion“ nochmals für die Deutsche Grammophon auf. Im Jahr 1980 entstanden neue Planungen für große Projekte, unter anderem für eine dreiwöchige Tournee durch Japan, die im Mai 1981 stattfinden sollte.
Der Münchener Bach-Chor nach Karl Richters Tod (1981-1984)
Am 15. Februar 1981 erlag Karl Richter in seinem Münchner Hotelzimmer einem Herzinfarkt. Mit seinem Tod zerbrach die einzigartige Symbiose, die über Jahrzehnte das Miteinander von Bach-Chor, Bach-Orchester und Dirigent geprägt hatte. Für den Chor stellte sich ebenso wie für die Fachwelt und das Publikum die Frage nach der Zukunft des Chores ohne seinen legendären Gründer. Schnell einigte man sich jedoch intern darauf, den Versuch eines Neuanfangs zu wagen und den Chor langfristig in eine Tradition zu überführen, die unabhängig von der Person des jeweiligen Künstlerischen Leiters Bestand haben sollte.

Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger gestaltete sich schwierig. Glücklicherweise fand sich in Ekkehard Tietze, der dem Chor auch von der DDR aus seit dem ersten gemeinsamen Konzert in Ansbach 1964 stets verbunden geblieben war, sofort ein geeigneter Interimsleiter. Tietze, 1914 in Erlbach/Vogtland geboren, hatte seine musikalische Ausbildung ebenfalls in Leipzig erhalten und war mit Karl Richter seit dieser Zeit befreundet gewesen. 1958 hatte er bei Richters erster Plattenaufnahme der „Matthäus-Passion“ schon als Organist mitgewirkt. Von 1958 bis 1979 war er in Potsdam als leitender Kirchenmusiker tätig und war nach seiner Pensionierung nach München übersiedelt, wo er seitdem auch bei mehreren Konzerten des Bach-Chores an der Orgel gesessen und für Karl Richter immer wieder Chorproben geleitet hatte. Tietze dirigierte nun zunächst die offizielle Trauerfeier für Karl Richter in der Markuskirche, bei der auch etliche ehemalige Chormitglieder mitwirkten, und übernahm dann die regelmäßigen Proben des Chores. Er bereitete den Chor auf die verschiedenen Gastdirigenten vor, zuerst auf das gemeinsame Gedenkkonzert für Karl Richter unter der Leitung von Leonard Bernstein im Mai 1981.

In der Übergangszeit leitete er jedoch auch zahlreiche Konzerte des Chores selbst, so u.a. 1981 die allen Beteiligten unvergessliche „Johannes-Passion“ im Kongreßsaal des Deutschen Museums unmittelbar nach Karl Richters Tod, das „Weihnachtsoratorium“ 1983, eine Anzahl von Motetten-Konzerten und die Weihnachtsliederabende 1981, 1982 und 1983.
Die kompetente, von jahrzehntelanger Erfahrung geprägte und selbstlos bescheidene Leitung des Chores durch Ekkehard Tietze schuf dem Ensemble erst den Raum, sich in Ruhe von der übermächtigen Gründerpersönlichkeit Richters zu lösen und nach einem geeigneten Nachfolger und neuen Wegen seiner Existenz zu suchen. Ab Sommer 1981 stand eine ganze Reihe von Gastdirigenten vor dem Chor.

Einige davon waren Gastdirigenten, andere präsentierten sich als Kandidaten für die Richter-Nachfolge. So konzertierte der Münchener Bach-Chor zwischen 1981 und 1984 u.a. mit Rudolf Barshai, Wolfgang Helbich, Diethard Hellmann, Laszlo Heltay, Wolfgang Gönnenwein, Christian Kabitz, Arnold Mehl, Hans-Martin Rauch, Bernd Stegmann und Gothart Stier, ohne dass sich jedoch schon eine konkrete Lösung für die Nachfolgefrage abgezeichnet hätte. Im August 1983 war der Bach-Chor noch einmal bei der Bach-Woche Ansbach zu Gast. Die bereits erwähnte Konzertreise nach Japan im Mai 1981 hatte Günter Jena übernommen, der bei Karl Richter studiert hatte und nach erfolgreichen Jahren in Würzburg damals als Kirchenmusiker an St. Michaelis in Hamburg tätig war.
Bereits im Juli 1982 kam es zu einer Verpflichtung des damaligen Wuppertaler Generalmusikdirektors Hanns-Martin Schneidt für ein Konzert mit J. Haydns „Die Schöpfung“ in der Basilika Ottobeuren. Bei einer weiteren Aufführung in Ottobeuren im Sommer 1983, diesmal mit G.F. Händels „Der Messias“, bestätigte sich, dass mit Hanns-Martin Schneidt, der zunächst keine Ambitionen auf die Übernahme der Leitung gehabt hatte, der geeignete Nachfolger für Karl Richter gefunden zu sein schien. Während der Proben zu „Ein Deutsches Requiem“ von J. Brahms im November 1983 gab der Chor ein überwältigendes Votum für Hanns-Martin Schneidt und damit für den Beginn von Vertragsgesprächen ab. Nach langwierigen Verhandlungen konnte in der Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche eine Sonderprofessur an der Münchner Musikhochschule geschaffen werden, so dass der Berufung Schneidts nach München nichts mehr im Weg stand. Bereits ab Herbst 1983 hatte Hanns-Martin Schneidt alle großen Konzerte des Chores selbst geleitet, im November 1984 wurde er definitiv zum neuen Künstlerischen Leiter bestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt.
Hanns-Martin Schneidt (1984-2001)

Mit Hanns-Martin Schneidt konnte der Münchener Bach-Chor eine Musikerpersönlichkeit verpflichten, die ideale Voraussetzungen für die künftige Arbeit des Ensembles mitbrachte. Wie Richter aus einer Pfarrersfamilie stammend, hatte der 1930 in Kitzingen am Main geborene Schneidt entscheidende musikalische Prägungen während seiner Zeit im Leipziger Thomanerchor (1940-1945) erfahren. Wichtige Stationen für den Kirchenmusiker waren München und (seit 1955) Berlin. Nach einem ersten, sehr erfolgreichen Konzert mit den Berliner Philharmonikern im Jahr 1960 hatte sich Schneidt neben seiner kirchenmusikalischen Tätigkeit zunehmend der großen Sinfonik sowie der Oper gewidmet. Von 1963 bis 1985 wirkte er als Generalmusikdirektor (und später auch musikalischer Chef der Oper) in Wuppertal, wo er 1985, schon von München aus, noch die langfristig angelegte Produktion von Richard Wagners „Der Ring des Nibelungen“ mit der „Götterdämmerung“ zu Ende brachte.

Hanns-Martin Schneidt bot dem Chor die Gewissheit, dass die von Karl Richter angelegte Arbeit im Sinne der großen Tradition des Kirchenmusikalischen Instituts in Leipzig fortgeführt werden würde. Es war ihm eine Selbstverständlichkeit, die großen Aufführungen von Bachs Werken in alter Kapellmeistermanier vom Cembalo aus zu leiten. Etliche Jahre lang spielte er, wie einst Richter, außerdem selbst in den Motettenkonzerten große Orgelwerke. Bei der Konzeption der Programme des Chores, insbesondere der Motettenprogramme, standen für ihn vorrangig inhaltliche und liturgische Überlegungen im Vordergrund. Für Schneidt war seine Arbeit mit dem Bach-Chor in erster Linie eine der wichtigsten Formen geistlicher Verkündigung in einer schnelllebigen Zeit. Musik als pures „L’art pour l’art“ und jegliche äußere Effekthascherei lehnte er vehement ab, bisweilen ohne Rücksicht auf eigene Interessen. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – brachte er als versierter Opern- und Orchesterdirigent neue musikalische Impulse in seine Arbeit mit dem Chor ein, die sich mit seiner eigentlichen musikalischen Heimat zu einer glücklichen Symbiose verbanden, wie eine Kritikerin 1988 feststellte: „Als Sternstunde wird die Aufführung von Verdis „Messa da Requiem“ in die Annalen des Münchener Bach-Chores eingehen, und ohne Zweifel hat Hanns-Martin Schneidt hiermit einen Höhepunkt seiner Karriere erreicht.

Aufs Glücklichste verband sich hier die Erfahrung des Operndirigenten mit der des Bach- und Schütz-Erprobten: so neu, als habe man sie noch nie vernommen, teilte sich diese umstrittene Totenmesse mit.“ (Ursula Hübner, Münchner Merkur) Der Live-Mitschnitt dieses Konzertes vom 30.10.1988 mit internationalen Sängern wie Sharon Sweet, Jard van Nes, Francisco Araiza und Simon Estes erschien bei „Arte Nova“ auf CD.
Unter der Leitung von Hanns-Martin Schneidt veränderte sich der Klang des Chores: War der frühe Bach-Chor oft wegen seines direkten, klaren, stellenweise an einen Knabenchor erinnernden Klangcharakters gerühmt worden, so setzte Schneidt ganz auf die Erziehung zu einem weichen, vollen Klang, in dem immer die Interpretation vom gesungenen Wort her im Vordergrund stand. In den Jahren nach der Bestellung des neuen Künstlerischen Leiters erweiterte sich auch beständig das Repertoire; in manchen Fällen wurden auch Werke wieder einstudiert, die in der Frühzeit des Bach-Chores bereits regelmäßig zur Aufführung gelangt waren. Neu hinzu kamen große romantische Chorwerke wie Rossinis „Stabat Mater“, Verdis „Quattro pezzi sacri“, „Te Deum“ und „Requiem“ von Berlioz und Bruckners „Messe f-Moll“, aber auch wenig gespielte barocke Werke wie Händels „Cäcilien-Ode“, und zahlreiche Motetten aus der Zeit vor J. S. Bach und Werke des 20. Jahrhunderts. Auch Carl Orffs „Carmina burana“ wurden vom Bach-Chor erstmals in der Ära Schneidt aufgeführt.
Die Kontinuität des Übergangs von Richter zu Schneidt zeigte sich auch darin, dass zahlreiche Orchestermusiker und eine Vielzahl namhafter Solisten dem Chor auch in der neuen Phase seines Bestehens die Treue hielten und regelmäßig mit dem Ensemble konzertierten. Stellvertretend für das Bach-Orchester werden hier der Geiger und Konzertmeister Kurt Guntner und der Solocellist Helmar Stiehler genannt. Bei den Sängern waren Edith Mathis, Helen Donath, Hermann Prey, Peter Schreier, Dietrich Fischer-Dieskau, Siegmund Nimsgern und Julia Hamari, um nur einige von ihnen zu nennen, auch in der achtziger und neunziger Jahren häufige und gern gesehene Konzertpartner des Chores. Nicht zuletzt über seine Tätigkeit als Professor an der Hochschule für Musik gelang es Hanns-Martin Schneidt aber auch zusehends, junge, vielversprechende Solisten neu an den Chor zu binden. So präsentierten sich z.B. Juliane Banse, Matthias Görne, Simone Nold, Thomas Quasthoff und Dorothea Röschmann im Rahmen eines Bach-Chor-Konzerts jeweils erstmalig dem Münchner Publikum.
Unter Schneidts Leitung konzertierte der Münchener Bach-Chor auch wieder verstärkt auswärts, wo er in seiner neuen Formation auf Begeisterung stieß, in der auch Erleichterung über den erfolgreichen Fortbestand des Chores zu spüren war. So versah der Mannheimer Morgen am 25.4.1988 eine Konzertkritik schlicht mit dem Titel „Triumphale Wiederkehr“. Engagements führten den Chor weiterhin zu den gewohnten Konzerten nach Ottobeuren (1985,1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1996, 1999), nach Italien (Rom 1989, Cremona 1994, Mailand 1996, Turin 1997, Toskana 1998 und 2000), nach Spanien (Madrid 1989) und auf einige Konzertreisen innerhalb Deutschlands mit den Schwerpunkten Leverkusen, Frankfurt, Mannheim und Düsseldorf. Auch das Fernsehen interessierte sich wieder für den Chor: 1988 produzierte das ZDF ein geistliches Programm in St. Anna zu Augsburg, 1995 entstand eine Fernseh-Produktion der „Weihnachts-Historie“ von Heinrich Schütz und 1998 nahm das Bayerische Fernsehen in der restaurierten Allerheiligen-Hofkirche ein Programm u.a. mit Werken von Schütz, Bach, Bruckner und Reger auf. Regelmäßige Hörfunk-Produktionen und Konzertmitschnitte ergänzten die Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk.
Wenn auch die Fülle der Konzertverpflichtungen mit derjenigen in den großen Richter-Jahren nicht unmittelbar vergleichbar war, so war doch das Pensum, das der Chor während einer Saison zu bewältigen hatte, auch in der Ära Schneidt beachtlich. Das Jahresprogramm 1992 weist beispielsweise 12 Konzerte des Bach-Chores in München auf, dazu kamen in diesem Jahr Konzertverpflichtungen beim Bodensee-Festival in Konstanz, in Ottobeuren, in Mannheim, in Frankfurt und in Aufkirchen, insgesamt etwa 20 Konzerte. Trotz der programmatischen Kontinuität der Arbeit und der ungebrochenen Aktivität und Wirkung des Münchener Bach-Chores fielen in die Ära Schneidt tiefgreifende strukturelle und organisatorische Veränderungen. Bereits Anfang der achtziger Jahre zeigte sich, dass der bis dahin als eingetragener Verein eigenverantwortlich und ohne regelmäßige Zuschüsse agierende Konzertveranstalter „Münchener Bach-Chor“ aus eigener Kraft angesichts rapid steigender Veranstaltungskosten und Künstlerhonorare in München dauerhaft nicht würde überleben können. Zunehmend stellte jedes Konzert ein bedeutendes finanzielles und damit existentielles Risiko für den Chor da, so dass sich Programmgestaltung und Kalkulation überwiegend am erwarteten Publikumszuspruch orientieren mussten. Dies schränkte die künstlerische Freiheit des Chores und seines Leiters erheblich ein.
In dieser Situation wurde 1987 auf Initiative von Prof. Dr. Theodor Bücher der Förderkreis „Freunde des Münchener Bach-Chores“ gegründet, der seither als eingetragener Verein Privatpersonen und Firmen als Förderer des Chores vereint. Ergänzt wurde der Förderkreis 1994 durch ein hochrangig besetztes Kuratorium, dessen Vorsitz bis heute der Münchener Oberbürgermeister Christian Ude innehat, das aber darüber hinaus führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kirche als Fürsprecher und Förderer des Chores gewinnen konnte. Der neue Freundeskreis sicherte wiederholt wichtige Vorhaben wie die auch unter Schneidts Leitung wieder in regelmäßigen Abständen durchgeführten Münchener Bach-Feste (1988, 1990, 1992, 1994, 1996 und 2000). Auch der damalige Bundespräsident Johannes Rau, der bereits anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Chores 1994 ein Konzert in der Philharmonie besucht hatte, konnte als Mitglied des Kuratorium gewonnen werden. Im Jahr 2000 ließ er es sich nicht nehmen, zu Beginn des Bach-Fests in der Philharmonie eine kurze Rede zu halten.
In die Ära Schneidt fiel schließlich auch die Einweihung der neuen Philharmonie am Gasteig im Jahr 1985. Im Rahmen der Eröffnungskonzerte führte der Chor in einer Gemeinschaftsproduktion mit den Münchner Philharmonikern unter der Leitung von Hanns-Martin Schneidt Händels Oratorium „Judas Maccabäus“ auf. Dennoch blieb der Chor mit seinen großen Konzerten noch zwei weitere Jahre in seinem angestammten Konzertsaal, dem Kongreßsaal des Deutschen Museums, bis dessen Umbau schließlich den Umzug in die Philharmonie unumgänglich machte.
Das Jahr 1997 brachte eine einschneidende Veränderung: Der Münchener Bach-Chor gab seine von Beginn an gewahrte Eigenständigkeit als Konzertveranstalter auf und wurde vom Veranstalter Tonicale verpflichtet. Nunmehr wurden die Konzerte des Münchener Bach-Chores in dessen Reihe der „Münchener Bach-Konzerte“ integriert. Für den Bach-Chor war dies ein bedeutender Schritt, der einerseits eine Einschränkung der gewohnten künstlerischen Gestaltungsfreiheit bedeutete, andererseits aber eine dauerhafte finanzielle Absicherung seiner Konzerte ermöglichte.
Als Hanns-Martin Schneidt nach 17 Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit das Amt des Künstlerischen Leiters des Chores abgab, hatte er viel erreicht: Der Münchener Bach-Chor war aus einer Ausnahmesituation in eine stabile Tradition überführt worden und so eine feste Größe im deutschen Musikleben geblieben. Etliche Konzertmitschnitte und mehrere CD-Produktionen spiegeln eindrücklich das hohe Niveau des Chores in diesen Jahren wider. Für seine Arbeit mit dem Chor wurde Hanns-Martin Schneidt mehrfach ausgezeichnet, so mit der Medaille „München leuchtet“, dem Bundesverdienstkreuz und dem Bayerischen Verdienstorden. Der Münchener Bach-Chor selbst wurde in dieser Zeit u.a. mit dem Preis der Bayerischen Volksstiftung beim Verfassungstag 1988 und dem Stiftungspreis der „Bücher-Dieckmeyer-Stiftung zur Förderung der Kirchenmusik in Bayern“ gewürdigt.
Interimszeit unter Philipp Amelung ( 2001 – 2005 )

Nach Schneidts Abschied im April 2001 übernahm der junge Dirigent Philipp Amelung (ehemaliges Mitglied und Solist des Tölzer Knabenchors) kommissarisch die Leitung des Ensembles. Er bereitete den Chor auf Konzerte mit Gastdirigenten vor und dirigierte häufig auch selbst Aufführungen des Bach-Chores in der Markuskirche sowie bei traditionellen auswärtigen Verpflichtungen wie dem jährlichen Vorweihnachts-Benefiz-Konzert in der Wallfahrtskirche Aufkirchen. Ab Sommer 2001 arbeitete der Chor mit verschiedenen Gastdirigenten, darunter Hansjörg Albrecht, Oleg Caetani, Christian Kabitz, Gilbert Levine, Ralf Otto, Peter Schreier, Bruno Weil und Stefan Weiler.

Internationale Beachtung erfuhr der Chor vor allem bei einem Gedenkkonzert für die Opfer des 11. September 2001 mit „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms, zu dem er 2002 nach Krakau/Polen eingeladen worden war. Das Konzert wurde in einer Direktübertragung vom Polnischen Fernsehen in Europa und auch in Amerika ausgestrahlt und wenige Wochen später vom WDR in Deutschland noch einmal gesendet. Gastspielverpflichtungen führten den Chor außerdem nach Chemnitz, Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim und zum Festival de Pollença nach Mallorca.
Im Leiter des Bachchors Mainz, Professor Ralf Otto, hatte der Chor zunächst seinen Wunschkandidaten für die Nachfolge von Professor Schneidt gesehen. Die Verhandlungen um eine Berufung Ottos auf eine Professur in München blieben jedoch erfolglos.
Hansjörg Albrecht ( seit 2005 )

Nach einer Reihe anspruchsvoller Konzerte, darunter einem Abend mit Bach-Motetten, einem A-Capella-Programm mit Werken von Max Reger, Samuel Barber und Francis Poulenc und schließlich einem Bach-Kantaten-Abend, entschlossen sich die Chormitglieder im Februar 2005 dazu, Hansjörg Albrecht zum neuen Künstlerischen Leiter zu berufen. Der Organist und Dirigent, aus Freiberg in Sachsen stammend, war auf Empfehlung von Peter Schreier zu einem Gastdirigat eingeladen worden und hatte 2003 das traditionelle Motetten-Konzert zu Bachs Todestag dirigiert. Seit Herbst 2005 ist Albrecht damit der dritte Künstlerische Leiter des Bach-Chors.
Wie seine Vorgänger in der Tradition eines großen Knabenchores aufgewachsen, ist auch er ein exzellenter Organist und Cembalist, der die Bachschen Passionen und großen Barockwerke vom Cembalo aus leitet. Als Organist konzertiert er weltweit und kann inzwischen auf eine beachtliche Anzahl an CD-Einspielungen verweisen.
Albrechts Arbeit ist geprägt durch eine ungewöhnliche und mutige Programmatik der Konzerte, durch Barock-Aufführungen, die der historischen Aufführungspraxis nahestehen, durch eine musikalische Arbeit, die die Neugier des Chores immer aufs Neue fordert. In der Presse wurde der Aufbruch zu „neuen Ufern“ einhellig gefeiert.
Die alljährliche Aufführung der Matthäus-Passion am Karfreitag und des Weihnachtsoratoriums im Dezember blieben weiterhin fester Bestandteil des Repertoires ebenso wie die regelmäßigen Aufführungen der großen Chorwerke Bachs, Händels, Mozarts und Beethovens. Darüber hinaus tauchten aber in der neuen Programmgestaltung Komponisten auf, die bis dahin in den Konzerten des Bach-Chores noch keine Rolle gespielt hatten, wie Francis Poulenc, Maurice Duruflé, Ralph Vaughan Williams (A Sea Symphony), Arthur Honegger (König David), Leonard Bernstein, Arvo Pärt, Enjott Schneider.
„Bach Modern“ wurde zum neuen Motto und Albrecht konzipierte immer neue Programme mit Parallelen und Querverbindungen moderner und zeitgenössischer Musik zu Johann Sebastian Bach.
So wurden zum Beispiel im traditionellen Konzert zu Bachs Todestag am 28. Juli in den letzten 13 Jahren Linien zu Schumann, Reger, Pärt, Nystedt, Schneider, Mirsojew, Helmschrott und Messiaen gezogen.
Erste Auslands-Engagements führten den Chor unter Hansjörg Albrecht mit der Matthäus-Passion nach Turin, Danzig und Warschau. 2007 gastierte der Chor mit dem gleichen Werk unter der Leitung von Günter Jena bei den Festspielen in Oberammergau, zusammen mit dem Hamburg Ballett in der legendären Choreographie, Inszenierung und Ausstattung von John Neumeier.
Der Chor wurde wieder vermehrt zu Musikfestivals eingeladen, gastierte bei der ION (2010), beim Heidelberger Frühling (2011), regelmäßig bei den Europäischen Wochen Passau, im Festspielhaus Baden-Baden (2011), dem Chiemgauer Musikfrühling (2013),den Musikfestspielen Saar (2013), mehrfach bei den Tölzer Orgelfesttagen und dem Schwazer Orgelsommer, im Großen Festspielhaus Salzburg (2014).
Im Jahr 2010 wagte der Chor den Schritt zurück in die Selbständigkeit und löste den seit 1997 bestehenden Vertrag mit dem Konzertveranstalter Tonicale Musik & Event GmbH. Nur die Traditionstermine der Matthäus-Passion und des Weihnachts-oratoriums und ein bis zwei zusätzliche Konzerte pro Saison werden weiterhin von Tonicale veranstaltet, für alle übrigen Konzerte zeichnet jedoch seither der MBC alleine verantwortlich. Diese Umstrukturierung bedeutete nun für die seit jeher ehrenamtlichen Vorstände eine erhebliche Mehrbelastung, die nur mit Hilfe der neugeschaffenen Geschäftstelle und eines ehrenamtlichen Finanzcontrollers zu bewältigen war.
Die stark wachsende Konkurrenz in der Musikszene Münchens verlangte nach neuen Ideen und so wurde auf Initiative des langjährigen Vorstandes Philipp Eder in enger Zusammenarbeit mit Hansjörg Albrecht die Akademie des Münchner Bach-Chores gegründet. Über das Konzertprogramm hinaus sollten neue Akzente gesetzt werden – Führungen, Vorträge, Kulturreisen, Jugendarbeit, Gesprächskonzerte, Museumskonzerte. In den Jahren 2011 bis 2015 fanden Konzerte mit interessanten Gesprächspartnern aus Religion, Wissenschaft, Musik, Theater und Philosophie statt , so zum Beispiel Prof. Dr. Harald Lesch, Prof. Dr. Stollberg, Stadtdekanin Kittelberger, Peter Schreier, Christian Stückl, Helmut Rilling, Enjott Schneider, K.F. Beringer. Dazu kamen thematisch pointierte Konzerte in verschiedenen Museen Münchens (Nationalmuseum, Alte Pinakothek, Jagdmuseum und Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke), die von der Presse überaus positiv begrüßt wurden. Seit 2015 ruht die Tätigkeit der Akademie aus finanziellen Gründen. Künstlerischer Partner des Chores blieb das an Tonicale gebundene Bach Collegium München. Für die in Eigenregie veranstalteten Konzerte aber baute Hansjörg Albrecht das Münchener Bach Orchester neu auf und intensivierte dessen Aktivitäten. CDs entstanden, das MBO gastierte bei verschiedenen Festivals und hat mittlerweile zwei sehr erfolgreiche Japan-Tourneen absolviert (2015, 2017).
2014 konnte der 60. Geburtstag des Münchener Bach-Chores mit einem Festkonzert im Prinzregententheater gefeiert werden, den anschließenden Empfang im Gartensaal richteten die Freunde des Münchener Bach-Chores aus, die seit 1987 den Chor tat- und finanzkräftig unterstützen. Der Chor reiste wieder regelmäßig nach Italien und arbeitete mit Orchestern im Ausland zusammen wie dem Ensemble orchestral Paris (2012) Orchestra della Toscana (2014), Staatliches Akademisches Kammerorchester Russland (2016 in Moskau), Haydn Orchester von Bozen und Trient (2016 in Pisa), Berliner Camerata ( 2016 Tournee in Südfrankreich), Sinfonieorchester der Universität Mozarteum (2016 in Salzburg), Franz Liszt Kammer-orchester ( 2017 in Budapest).
Vieles an der Struktur des Bach-Chores ist von 1954 bis heute gleich geblieben: Nach wie vor ist der Chor ein Laienensemble, dessen Mitglieder in der Ausbildung sind oder den verschiedensten Berufen nachgehen. Auch heute noch wird zweimal wöchentlich geprobt. Jeder neue Anwärter kommt über ein Vorsingen in den Chor und damals wie heute ist entscheidend, dass große, gängige Chorwerke ebenso wie unbekanntere Literatur zügig und professionell einstudiert werden können. Der Chor hat in den letzten Jahren viele engagierte junge Mitglieder aufnehmen können.
Andrea Bliese hat diesen Text ursprünglich für das Jubiläums-Programmheft 92/2004 geschrieben. Er wurde 2008 von Klaus Stadler und 2018 von Susanne Schneidt durchgesehen, aktualisiert und ergänzt.
183,99 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details
34,99 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details
15,00 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details
15,00 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details
15,00 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details
15,00 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details
15,00 € inkl. 0 % MwSt. zzgl. Versandkosten Details